|
 GILLES
LEROY GILLES
LEROY
ALABAMA SONG
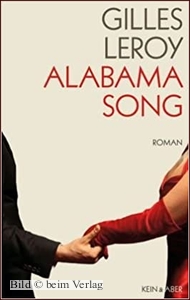 Adieu
Zelda, es war mir eine Ehre Adieu
Zelda, es war mir eine Ehre
Mit dem Prix Goncourt für seinen Roman «Alabama
Song» ist dem französischen Schriftsteller Gilles Leroy 2007 der
Durchbruch gelungen. Der mit nur zehn Euro dotierte Preis ist quasi
ein literarischer Ritterschlag, er bedeutet regelmäßig einen
anhaltenden, lukrativen Bestsellerstatus in Frankreich. Die deutsche
Ausgabe erschien ein Jahr später als erst drittes Buch aus seinem
umfangreichen Œuvre, das in Übersetzung vorliegt. Der brechtsche
Titel bezieht sich auf den amerikanischen Staat, in dem Zelda
Fitzgerald geboren wurde. Sie war eine Galionsfigur der
hedonistischen ‹flapper girls› in den Zwanziger Jahren, zu Zeiten
der Prohibition.
Die lebenslustige Ich-Erzählerin Zelda, Tochter
einer angesehenen Familie aus Montgomery, Alabamas Hauptstadt,
heiratet nach einigem Hin und Her den selbstbewussten jungen
Schriftsteller F. Scott Fitzgerald. Vor ihm liege eine große
Zukunft, hatte er ihr versichert. Und nach vielen
Brot-und-Butter-Arbeiten gelang ihm 1925 mit dem Roman «Der große
Gatsby» tatsächlich ein sensationeller Erfolg, der ihm neben dem
Ruhm auch sehr viel Geld einbrachte. Das publicity-süchtige Ehepaar
lebte daraufhin in Saus und Braus, sie waren mit vielen Größen aus
Literatur und Filmindustrie eng befreundet. Der Champagner floss in
Strömen, beide verkörperten geradezu die ‹Roaring Twenties›. Nicht
nur wegen der Prohibition lebten sie dann zeitweise in Frankreich,
wo Scott Fitzgerald zur Gruppe der von Gertrude Stein als ‹Lost
Generation› bezeichneten Kriegsteilnehmer um Ernest Hemingway
zählte. Mit ihm war er, auch alkoholbedingt, eng befreundet. Der
spätere Nobelpreisträger hielt allerdings nicht viel von Fitzgeralds
Kunst, und tatsächlich blieb ‹Gatsby› sein einziges herausgehobenes
Werk.
Die unkonventionelle Zelda, erstaunlichste
‹Southern Belle› ihrer Generation, geradezu eine Symbolfigur als
Südstaaten-Schönheit, hatte nebenbei Liebesaffären, die ihren Mann
aber kaum störten, die allenfalls seine Eitelkeit verletzten. Es gab
viel Streit zwischen ihnen, und neben Scotts unmäßigem Alkoholkonsum
holte er sich ungeniert auch noch einen Liebhaber ins Haus, was ihr
Zerwürfnis weiter verschärfte. Zelda, die selber Romane und
Kurzgeschichten schrieb, war auch als Malerin tätig und widmete
sich, altersbedingt jedoch aussichtslos, dem Ballett. Ihre
Manuskripte jedoch waren gut, sie wurden ihr sehr oft von Scott
weggenommen, der viele davon unter seinem Namen veröffentlichte. Sie
brachten als seine Werke deutlich mehr Geld ein, die Verlage sahen
das ebenso. Als Zelda schließlich ernsthafte psychische Probleme
bekam und immer öfter in Kliniken war, erklärte ihr mal einer der
Psychiater, sie sei eifersüchtig auf den Erfolg ihres Mannes. Ihr
Wahn rühre daher, unbedingt erfolgreich sein zu müssen und ständig
Publicity zu brauchen. «Sie haben nicht geheiratet, junge Frau. Sie
haben einen Reklamevertrag unterschrieben».
Der zwischen 1918 und 1943 angesiedelte Roman ist
in fünf Abschnitte unterteilt, die nicht chronologisch erzählt
werden, sondern kapitelweise vor und zurück springen. Gilles Leroy
berichtet in einer angenehm lesbaren Sprache über das turbulente
Leben seiner liebevoll gezeichneten Figuren, die einem trotz all
ihrer Verrücktheit und Geltungssucht schnell sympathisch werden.
Aber er betont in seinem informativen Nachwort auch: «Alabama Song
will als Roman und nicht als Biografie der historischen Person Zelda
Fitzgerald gelesen werden». Und er zählt detailliert auf, was alles
fiktional ist an seiner Geschichte. Im letzen Kapitel schließlich
berichtet er als Autor über seine Recherchen, als er im Jahre 2007
das Fitzgerald-Museum in Montgomery besucht. Er findet
Zeitungsausschnitte des New York Herald vom 11. März 1948, die vom
tragischen Tod der 47jährigen Zelda Fitzgerald beim Brand in einer
psychiatrischen Klinik berichten. Wie sehr ihm seine Heldin ans Herz
gewachsen ist, beweisen die letzten Worte dieses Schlusskapitels:
«Adieu, Zelda. Es war mir eine Ehre.»
4*
erfreulich - Bories vom Berg
- 12. Mai 2021

© Copyright 2021
|