|
 TONI MORRISSON TONI MORRISSON
SEHR BLAUE AUGEN
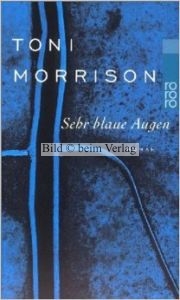 Gelungenes Debüt einer großen Autorin Gelungenes Debüt einer großen Autorin
Toni Morrison, Grande Dame der amerikanischen Literatur,
thematisiert in ihrem 1970 erschienenen ersten Roman «Sehr blaue Augen» die
Wirkung einer Schönheitsnorm, die sich am weißhäutigen Bevölkerungsteil der
Vereinigten Staaten orientiert, wo blaue Augen als besonders attraktiv gelten.
Dreiundzwanzig Jahre und viele Romane später befand das Nobelkomitee, die
farbige Autorin verdiene den Preis «für ihre durch visionäre Kraft und poetische
Prägnanz gekennzeichnete literarische Darstellung einer wichtigen Seite der
US-Gesellschaft». Denn die Schriftstellerin sieht sich als selbstbewusste
Hüterin einer afroamerikanischen Identität, deren Wurzeln von der afrikanischen
Herkunft über die Sklavenzeit bis hin zum unermüdlichen Kampf gegen
Rassendiskriminierung reichen.
Es beginnt gleich drastisch: «Wenn auch niemand darüber
spricht: es gab im Herbst 1941 keine Ringelblumen. Wir glaubten damals, die
Ringelblumen gingen nicht auf, weil Pecola von ihrem Vater ein Baby bekam». Mit
«wir» sind die neunjährige Ich-Erzählerin Claudia und ihre ein Jahr ältere
Schwester Frieda gemeint. Als die elfjährige Pecola daraufhin vom Bezirksamt
vorübergehend in ihr armseliges Haus eingewiesen wird, müssen sie sich nun zu
dritt das Bett teilen. Anschaulich schildert Morrison den Alltag der zwei
Mädchen zwischen Schule und ärmlichem Elternhaus, ihre Händeln mit den
Gassenjungen, berichtet vom Bordell in der Nachbarschaft, vom Untermieter, der
Frieda unsittlich berührt. «Der Vorspruch und die Kapitelüberschriften in diesem
Buch stammen aus den Leseheften Dick and Jane», wird im Nachwort erläutert, und
mit eben diesen kitschig süßlichen Sätzen aus dem Alltag einer gutbürgerlichen
weißen Familie verdeutlicht Morrison äußerst ironisch den Kontrast zum
bedrückenden Geschehen in ihrem Roman.
In Rückblicken und häufig zwischen auktorialer und personaler
Erzählweise wechselnd wird über die leidvolle Geschichte der Breedloves
berichtet, Pecolas Eltern. Aus der ehemals großen Liebe zwischen Pauline und
Cholly entwickelt sich mit zunehmender Trunksucht des Mannes eine Ehehölle. Bis
in die frühe Kindheit zurückreichend wird die Vorgeschichte dieser tragischen
Ehe erzählt, Cholly wurde als Kleinstkind von seiner Mutter brutal auf dem
Müllplatz ausgesetzt. Im Wechsel erzählt Pauline aus der Ich-Perspektive über
den Beginn ihrer Beziehung, über das frühe Liebesglück, über den lustvollen Sex
des Paares. Ein Koitus der Beiden wird derart stimmig und realistisch
beschrieben, detailliert und doch nie obszön werdend, wie ich es bisher noch
nirgendwo gelesen habe.
«Es war einmal ein alter Mann» beginnt die Geschichte des
ehemaligen Pastors Elihue, den seine Frau verließ, einem Inder, der
Seifkopfpastor genannt wird und seine Dienste als Traumdeuter anbietet. «Lass
mich Dir nun von den Brüsten kleiner Mädchen erzählen» schreibt er in einem
Brief an Gott. «Ich konnte, wie Du wohl noch weißt, meine Hände, meinen Mund
nicht von ihnen lassen», eine Neigung, die ihm allerdings keinerlei
Schuldgefühle abnötigt. Eines Tages sucht die ungewöhnlich hässliche Pecola ihn
auf, regelrecht besessen vom lebenslangen Trauma ihrer mangelnden Attraktivität.
Er schreibt: «Weißt Du, weswegen sie kam? Blaue Augen. Neue blaue Augen, sagte
sie. Als ob sie sich Schuhe kaufte». Es gelingt ihm durch eine suggestive List,
den flehentlichen Wunsch der Wahnsinnigen zu erfüllen. Fortan erblickt Pecola
strahlend blaue Augen, wenn sie in den Spiegel schaut, und Claudia lässt sie, in
einem längeren Dialog am Ende des Romans, bereitwillig und mildtätig in ihrem
Glauben, der sie so glücklich macht.
Dieser Erstling stellt durch seine hoch verdichtete und komplexe
Erzählstruktur besondere Ansprüche an die Aufmerksamkeit des Lesers, man kann
ihn wie auch alle folgenden Romane als eine Hommage an die starken schwarzen Frauen
ansehen. Kämpferisch kritisiert Toni Morrison einen Rassenhass, der hier in
Selbsthass umgeschlagen ist. Ein gelungenes Debüt einer großen Autorin.
4*
erfreulich - Bories vom Berg - 5. April 2015

© Copyright 2015
|