|
 V.
S. NAIPAUL V.
S. NAIPAUL
EIN HAUS FÜR
MR. BISWAS
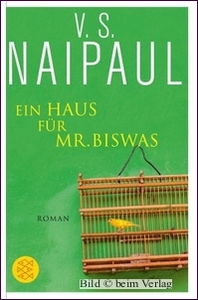 Lesespaß
aus kontrapunktischer Ironie Lesespaß
aus kontrapunktischer Ironie
In seinem Roman «Ein Haus für Mr. Biswas» erzählt
der Nobelpreisträger V. S. Naipaul die Lebensgeschichte eines
Journalisten, der als Außenseiter der Gesellschaft einen ständigen
Kampf mit den widrigen Umständen seines armseligen Lebens führt. Ort
des Geschehens ist die Karibikinsel Trinidad, aus deren indischem
Milieu auch der Autor stammt, der damit seinem eigenen Vater ein
literarisches Denkmal setzen wollte. Gleichermaßen Entwicklungs- wie
Familienroman, nehmen darin die Herausforderungen kein Ende, denen
der Sohn eines armen Landarbeiters wie ein Fluch zeitlebens
ausgesetzt bleibt, bis zu seinem Tod. Insoweit wäre «Pleiten, Pech
und Pannen» ein stimmigerer Titel für dieses trübsinnig machende
Buch.
Der zweiteilige, um Prolog und Epilog ergänzte
Roman wird in 16 Kapiteln chronologisch erzählt, er beginnt im
Kapitel «Pastorale» mit der Geburt des Protagonisten Mohun Biswas.
«‹Ein Junge, ein Junge›, jammerte die Hebamme, ‹aber was für ein
Junge! Verkehrt herum geboren, und mit sechs Fingern›». Ein zur
Hilfe gerufener Pandit beruhigt die aufgebrachte Mutter: «Es gibt
immer Mittel und Wege, mit solch unglücklichen Fügungen fertig zu
werden». Der weise Mann verordnet nicht nur, dass man das Kind vom
Wasser «in seiner natürlichen Form», also «von Flüssen und Teichen»,
fernhalten müsse, sondern auch, dass der Vater sein Kind die ersten
einundzwanzig Tage nach der Geburt nicht sehen dürfe. Am
einundzwanzigsten Tage aber müsse er das Kind sehen, und zwar nicht
direkt, sondern nur als Spiegelbild auf einer mit Kokosöl gefüllten
Messingschale. Mit einer Zweischillingmünze für seine Dienste
entlohnt, ist der Pandit «recht zufrieden, er hat mit weniger
gerechnet». Auf den mehr als siebenhundert Seiten des zutiefst
melancholischen Romans wirken solche amüsanten Szenen immer wieder
wohltuend kontrapunktisch. Bei all der Trübsal ist stilistisch zudem
immer auch ein ironischer Grundton vorhanden, der eine skeptische
Distanz des Autors zu dem sozialen Milieu offenbart, dem er ja
selbst entstammt.
Immer knapp bei Kasse, schlägt Mr. Biswas sich
mit allerlei Gelegenheitsjobs durchs Leben, um schließlich als
Journalist zu arbeiten. Irgendwann kommt er zufällig sogar zu einer
Frau und nebenbei dann bald auch zu einer Schar von Kindern. Durch
seine Ehe gerät er in den weitläufigen Familienclan seiner Frau, was
ihm weitere Probleme und sogar handfeste Konflikte beschert, weil
die neue Verwandtschaft ihn zusätzlich plagt und immer nur
verspottet. In seinem ständigen Kampf verliert er aber nie sein Ziel
aus den Augen: Er möchte irgendwann das titelgebende, eigene Haus
haben. Was ihm, nach vielen Umzügen und vorübergehendem familiären
Zusammenwohnen dann auch tatsächlich gelingt.
Als Misanthrop
zieht der Protagonist boshaft über viele seiner Mitmenschen her. Er
erzieht seine Kinder äußerst streng, sie sind ihm ähnlich
gleichgültig wie seine gefühlskalte, boshafte Frau, mit der er im
Dauerstreit liegt. Die vielen Figuren des Romans sind zumeist
unsympathisch, man bekommt keine Nähe zu ihnen als Leser, wozu
natürlich auch beiträgt, dass ein exotischer Schauplatz wie Trinidad
mit seiner Armut und seinen prekären Lebens-Verhältnissen einem
Deutschen gesellschaftlich fremd bleiben muss. Der pessimistischen
Stimmung angepasst, wird natürlich auch die zweifellos ja vorhandene
Karibik-Idylle mit ihren Traumstränden nicht thematisiert, das
lebensfrohe Trinidad der Touristen bleibt konsequent außen vor. Die
depressive Grundstimmung dieses voluminösen Romans, in dem so gut
wie nichts passiert und das Ende schon im Prolog vorweg genommen
wird, ist in ihrer Einförmigkeit auf Dauer nur noch langweilig. Denn
auch ein Erkenntnis-Gewinn ist kaum gegeben, man erfährt nichts
Neues aus dem tristen Mikrokosmos des Mr. Biswas, auf den sich der
Autor narrativ weitgehend beschränkt. Ein Minimum an Lesespaß lässt
sich allenfalls aus der kontrapunktisch wirkenden Ironie gewinnen,
mit der da erzählt wird.
2* mäßig - Bories
vom Berg - 12. März 2025

© Copyright 2025
|