|
 ANDRZEJ STASIUK ANDRZEJ STASIUK
DIE WELT HINTER DUKLA
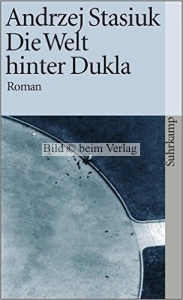 Transzendentale Herausforderung Transzendentale Herausforderung
Mit dem im Original 1997 erschienenen Roman «Die Welt hinter
Dukla» wurde der polnische Schriftsteller, Literaturkritiker und Journalist
Andrzej Stasiuk drei Jahre später schlagartig auch dem deutschen Lesepublikum
bekannt, sein Buch wurde 2008 sogar in die Anthologie «Hundert große Romane des
20. Jahrhunderts» der Süddeutsche Zeitung aufgenommen. Zu Recht? Fragt man sich,
denn die Rezeption war zwiespältig, einig war sich die Kritik nur darin, dass
die Lektüre anstrengend und der Roman weitgehend handlungslos sei.
«Um vier Uhr früh hebt die Nacht langsam ihren schwarzen
Hintern, steht vollgefressen vom Tisch auf und geht schlafen. Die Luft ist wie
kalte Tinte, sie fließt die Asphaltwege herab, zerläuft und gerinnt zu schwarzen
Seen. Es ist Sonntag, die Menschen schlafen noch, und deshalb sollte diese
Erzählung keine Handlung haben, kein Ding kann schließlich andere Dinge
verdecken, wenn wir zum Nichts streben, zu der Feststellung, dass die Welt nur
eine vorübergehende Störung ist im freien Fluss des Lichts.» Dieser Romananfang
bestätigt die Adjektive «anstrengend» und «handlungslos» eindrucksvoll, über die
Mühe des Lesens vermittelt der zitierte Text einen Eindruck, insbesondere wenn
man weiß, so geht es weiter bis zum Schluss, und die fehlende Handlung wird hier
explizit durch den Autor bestätigt.
Der Romantitel ist metaphorisch zu verstehen, er weist darauf
hin, dass die polnische Kleinstadt Dukla für den Ich-Erzähler mehr ist als ein
verschlafenes Provinznest am Rande der Karpaten, er sucht nichts weniger als
deren Genius loci, benutzt den Ort als Projektionsfläche transzendenter
Betrachtungen. «Ich komme immer wieder in dieses Dukla zurück, um es bei
unterschiedlichem Licht, zu unterschiedlichen Tageszeiten anzusehen.» Diese
nicht enden wollende Spurensuche nach der eigenen Kindheit, nach magischen
Orten, nach dem Geist der Schutzpatronin Amalia von Brühl, deren Sarkophag er
immer wieder besucht, ist der eigentliche Gegenstand dieses Erzählbandes. Die
wenigen den Roman bevölkernden Figuren bleiben konturlos wie der Ich-Erzähler
selbst, man erfährt so gut wie nichts von ihnen, und sie agieren auch nicht. Aus
allen Himmelsrichtungen kommend, mit verschiedenen Verkehrsmitteln, zu
verschiedenen Jahreszeiten, zu verschiedenen Stunden des Tages, bei Licht und
bei Dunkelheit, stets münden diese Besuche in tiefsinnige Beschreibungen von
Straßen, Plätzen, Gebäuden, der umgebenden Natur, lebender und toter Materie,
behandeln existenzielle Fragen in einer nimmermüden Suche nach dem Sinn hinter
alldem.
«Schon immer wollte ich ein Buch über das Licht schreiben.»
lässt uns der Erzähler wissen, «Ich wüsste nichts, was mehr an die Ewigkeit
erinnert». Das Vergehen der Zeit ist sein Thema, seine rastlose
Erinnerungsarbeit kreist um philosophische Grundfragen unserer Existenz. Diese
anspruchsvolle Thematik ist sprachlich metaphernreich umgesetzt in Textblöcke
ohne inhaltlichen Zusammenhang oder erkennbare Gliederung. Ein breit
dahinströmender Gedankenfluss, der den Leser zu häufigen Denkpausen zwingt, will
er all den Bildern folgen, die da so zahlreich heraufbeschworen werden. «Das
Bild, der Zwillingsbruder unseres Verstandes, wird uns überleben» lautet die
Erkenntnis. Auf den letzten Seiten wird die unkonventionelle, zu nichts
hinführende Erzählweise konkreter, in kurzen Kapiteln wird von einem glücklosen
Viehhirten, verschiedenen Tieren, Wetterphänomenen, zuletzt vom Himmel erzählt,
auf dem sich weiße Wolken zeigen. «Sie sehen aus wir Knochen, wie eine
zerstreute, nebulöse Wirbelsäule. Denn so wird es ganz am Ende sein. Sogar die
Wolken werden verschwinden, nur das himmelblaue, grenzenlose Auge wird bleiben
über den Resten.» Ob tollkühne Metaphorik und transzendente Reflexionen allein
den Leser zufrieden stellen können, muss jeder für sich entscheiden. Ich
jedenfalls war enttäuscht, auch die gekonnte Poetik des schmalen Erzählbandes
konnte da literarisch nichts mehr retten.
2*
mäßig - Bories vom Berg - 22. September 2016

© Copyright 2016
|