|
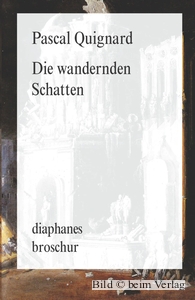 Unentschuldbare
Ignoranz Unentschuldbare
Ignoranz
Der in Frankreich hoch angesehene Schriftsteller
Pascal Quignard hat für sein 2002 erschienenes Werk «Les Ombres
errantes» den Prix Goncourt erhalten. Eine deutsche Übersetzung
erschien erst 13 Jahre später unter dem Titel «Die wandernden
Schatten». Als Verfasser eines umfangreichen, bedeutenden und in
diverse Sprachen übersetzten, vielschichtigen Werkes aus Romanen,
Erzählungen
und Essays ist er jedoch nach wie vor in Deutschland
weitgehend unbekannt. Der vorliegende Band ist der erste Teil eines
Schreibprojekts unter dem Titel «Letztes Königreich», welches einer
Wanderung durch die Biografie des Autors in permanentem Wechsel mit
einer Tour d’Horizon durch die Geschichte der Menschheit gleicht.
Dabei stehen die titelgebenden wandernden Schatten für das
Verborgene in der Welt, für das mit Worten kaum Fassbare.
In 55 Kapiteln sehr unterschiedlicher Länge
entwickelt Quignard ein grandioses Gedankengebäude, das er in Form
von Notizen, literarischen Skizzen, Gedankensplittern, Aphorismen,
rätselhaft Magischem, Naturbeobachtungen, exotischen Fremdzitaten,
historischen Kurzgeschichten oder Auszügen aus Erzählungen vor dem
Leser ausbreitet. Aus dieser Vielfalt heraus entwickelt sich beim
Lesen ein dichtes Geflecht verschiedenartigster Assoziationen, das
nicht immer leicht zu durchdringen ist. Ein thematischer Schwerpunkt
dieser Prosa ist das Schreiben selbst, wobei der Autor
beispielsweise solche Einsichten äußert: «Der Romanschriftsteller
ist der einzige Lügner, der die Tatsache nicht verschweigt, dass er
lügt». An anderer Stelle widmet er sich dem Lesen, mit sechs Kisten
Wein aus Épineuil und zwei mit Büchern gefüllten Postsäcken zieht er
sich in sein ländliches Refugium am Ufer der Yonne zurück, «Blieb
nur zu hoffen, dass niemand zu Besuch kommen würde». Die Ruhe, die
ihn umgab, war vollkommen. «Das Glück wurde immer größer. Ich las».
Und er stellt fest: «Wenn man ein Buch öffnet, weiß man nicht, wohin
man geht. Man lässt sich führen in Zeiten, an Orte, zu Gefühlen, mit
denen man sich sonst nicht ohne weiteres eingelassen hätte».
Besonders die Werke der Alten sind für Quignard
Inspirationsquelle, der Römer Lukrez zum Beispiel, die Chinesen Han
Yu und Laotse, der Japaner Tanizaki. Aber auch Descartes und Walter
Benjamin geben ihm Anregungen zum Denken, und sogar die Weisheiten
der Eskimos. Ihn interessieren «nur Gedanken, die zittern», erklärt
er dazu, keine feststehenden Erkenntnisse mithin, sondern dynamische
Denkprozesse. Seine historischen Erzählschnipsel beginnen zeitlich
beim letzten römischen Kaiser Syagrius, dessen Schattenanrufung bei
der Hinrichtung er zitiert, ferner schreibt er über den Theologen
Jean Duvergier de Hauranne, als Abt Saint Cyran genannt, der sich
dem Jansemismus gewidmet hat. Der historische Erzählbogen reicht
außerdem über die Mission des US-Seeoffiziers Matthew Perry von 1853
über den japanischen Überraschungs-Angriff auf Pearl Harbor bis zum
nationalen Trauma 9/11 in New York. Die Kunst ist ein weiteres Thema
für den Autor, mit dem er sich äußerst kritisch auseinandersetzt. Er
zitiert in diesem Zusammenhang sogar Herman Göring mit dem
Ausspruch: «Wenn ich das Wort Kultur nur höre, entsichere ich meine
Browning». Sein philosophisches Credo ist die Unabgeschlossenheit,
die Vergangenheit sei nichts weiter als eine einzige
Verfallsgeschichte.
In all diesen Meditationen ist
deutlich eine permanente Verweigerungs-Haltung von Pascal Quignard
erkennbar, die zuweilen sogar in Defätismus ausartet. Als radikaler
Aussteiger aus dem Literaturbetrieb hat er in der Normandie Zuflucht
gefunden für sein konsequent dem Denken gewidmetes Lebenswerk. Seine
hier als Buch vorliegende, fragmentarische Sammlung von Skizzen aus
seiner Gedankenwelt sprengt den Rahmen sämtlicher literarischen
Gattungen. Genau darin aber liegt der Reiz dieser außergewöhnlichen
Lektüre. Unentschuldbar angesichts dessen, was hierzulande mit
Buchpreisen geehrt wird, ist die dem Autor zuteil werdende Ignoranz!
|