|
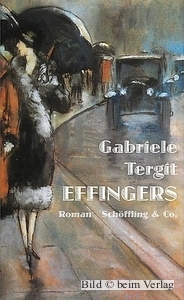 Literatur-Skandal Literatur-Skandal
Das Opus magnum «Effingers», der zweite Roman von
Gabriele Tergit, wurde seit der Erstausgabe 1951 mehrfach neu
aufgelegt, zuletzt 2019. Der Publikums-Erfolg jedoch blieb trotz
euphorischer Besprechungen im Feuilleton weitgehend aus. Hatte Thea
Dorn Recht, als sie erklärte: «Dass dieses Buch nicht längst fester
Bestandteil des deutschen literarischen Kanons ist, halte ich für
einen Skandal». 50 Jahre davor erschien mit «Die Buddenbrooks» der
erste «Gesellschaftsroman in deutscher Sprache von Weltgeltung».
Ohne Zweifel ist «Effingers» in diesem Genre inzwischen ebenfalls
ein Klassiker, nach Heinz Schlaffers Definition also «gleichermaßen
vergangen, erinnert und gegenwärtig», diese Neuauflage beweist es!
Über vier Generationen hinweg, von 1878 bis 1948,
wird in diesem opulenten Roman eine breit aufgefächerte
Familien-Chronik aus der großbürgerlichen, jüdischen Berliner
Gesellschaft erzählt. Als Klammer um das Geschehen dient anfangs und
zum Schluss je ein Brief eines der markantesten Protagonisten, des
Sohnes Paul aus der Uhrmacher-Familie Effinger im Städtchen
Kragsheim. Anfangs ist er als 17Jähriger noch ein Lehrling voller
Tatendrang, am Ende wartet er als 81jähriger, einst erfolgreicher
Industrieller auf seine Deportation ins Vernichtungslager. Er habe
«an das Gute im Menschen geglaubt», schreibt er resigniert, «Das war
der tiefste Irrtum meines verfehlten Lebens». Der im Buch
abgedruckte Stammbaum führt als zweiten Zweig den Bankier Markus
Goldschmidt aus Berlin als Stammvater der Familie auf. Anders als
bei Thomas Mann geht hier aber eine ganze Welt unter als Folge des
politischen Wahnsinns eines verbrecherischen Diktators, nicht nur
eine zunehmend degenerierte Kaufmanns-Familie.
Über weite Strecken liest sich dieser Roman als
detaillierte deutsche Gesellschafts-Studie über mehrere politische
Epochen hinweg, deren markanteste die wilhelminische Ära mit Erstem
Weltkrieg, Weimarer Republik und Inflationszeit, Machtübernahme der
Nazis und Zweiter Weltkrieg sind. Diese politischen und
gesellschaftlichen Umbrüche spiegeln sich im Leben der Effingers
wieder, wobei die ökonomische Bandbreite vom einfachen Uhrmacher
oder Krämerladenbesitzer bis zum Bankier und Großindustriellen
reicht. Die Religion betreffend geht die Spanne vom strenggläubigen
bis zum nicht praktizierenden Juden, wobei allerdings anzumerken
ist, dass die Religion, ganz anders als vielfach behauptet, nur eine
völlig nebensächliche Rolle spielt in dieser Familiensaga. Nur an
wenigen Stellen, zunehmend natürlich gegen Ende, hat sie überhaupt
mal Einfluss auf das Geschehen. Stattdessen sind es die üblichen
Fährnisse des Lebens, die im Blickpunkt stehen, allem voran die Ehe
als sinnstiftend für die Frauen früherer Zeiten. Überhaupt erstarkt
die weibliche Emanzipation im chronologischen Ablauf von geradezu
unglaublicher Spießigkeit, mit Anstandsdame beim Spaziergang des
künftigen Paares, bis hin zur selbstbewussten Entscheidung, was den
Ehepartner und vor allem Studium oder Berufswahl anbetrifft. Nicht
verheiratet zu sein oder Liebhaber zu haben ist dann irgendwann kein
Makel mehr für die selbstbewusst gewordene Frau.
Man merkt sprachlich den journalistischen
Hintergrund der Autorin, der dialogreiche Roman wird präzise und
ohne Ausschmückungen in kurzen Kapiteln, aber mit scharfem Blick für
Details erzählt. Neben dem abgedruckten Stammbaum sei ergänzend das
äußerst hilfreiche ‹Literaturlexikon› empfohlen, auf dessen diesem
Werk gewidmeter Internet-Seite nicht weniger als 131 Roman-Figuren
detailliert beschrieben werden. Als lebensnahe Informations-Quelle
über die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse ist «Effingers»
durchaus mit entsprechenden Werken Fontanes vergleichbar, und
erfreulicher Weise auch ähnlich genüsslich und den Horizont
erweiternd zu lesen. Dazu tragen besonders die klugen
philosophischen und kulturellen Erörterungen bei, die viele
Lebensbereiche und Geisteshaltungen abdecken. Thea Dorn hat völlig
Recht, ein Skandal!
|