|
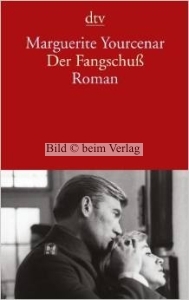 Tiefenwirkung Tiefenwirkung
Die unter Pseudonym schreibende Autorin mit
belgisch-französischen Wurzeln hat ihren 1939 erschienenen kurzen Roman «Der
Fangschuss» in Sorrent verfasst, fernab vom Handlungsort ihrer Geschichte im
Baltikum. Marguerite Yourcenar stellt ihren Ich-Erzähler, der morgens um fünf am
Bahnhof von Pisa auf seinen Zug nach Deutschland wartet, auf den ersten
eineinhalb Seiten kurz vor. «Es war die Dämmerstunde», schreibt sie, «in der
schöne Seelen zu Bekenntnissen und Verbrecher zu Geständnissen neigen und in der
selbst schweigsame Menschen gern Geschichten erzählen oder Erinnerungen
auskramen, um nicht einzuschlafen».
Und nun erzählt Erich von Lhomond, ein vierzigjähriger
ehemaliger preußischer Offizier, der in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg ein
Jahrzehnt als Kommandeur an verschiedenen Fronten gekämpft hat, seinen beiden
Kameraden eine Episode aus dem Bürgerkrieg gegen die Bolschewiken in Estland und
Kurland, wo er ein Freikorps befehligt hat. Man ist als Leser sofort mitgerissen
durch seinen, entfernt an Fontane erinnernden, ebenso angenehmen wie
kurzweiligen Plauderton, den man förmlich hört, nicht liest. Marodierende Banden
aus aufgelösten Truppenteilen sorgen für chaotische Zustände, der Tod ist
allgegenwärtig. In diesem Schlamassel nimmt Erich mit seinen Männern Quartier im
zerschossenen Schloss seines besten Freundes und Kampfgefährten Konrad von Reval
und trifft dort auf dessen Schwester Sophie. «Auch in der Liebe bin ich,
nebenbei bemerkt, fürs klassisch Einfache», sind seine Worte, und in der Tat
erweist er sich im Verlauf der Geschichte als nahezu emotionsloser, kühl
denkender Mensch, dem Frauen prinzipiell suspekt sind. Die burschikose
zwanzigjährige Sophie aber, die nichts von jungen Männern hält, hat sich Hals
über Kopf in ihn verliebt. Erich erfährt, dass sie Opfer einer Vergewaltigung
war, spricht aber nie mit ihr darüber. Als sie ihm schon bald offen ihre Liebe
erklärt und sich ihm unverblümt anbietet, ist er zwar in seiner Eitelkeit
geschmeichelt, hält sie jedoch auf Abstand, lässt außer inniger Freundschaft
keine intime Nähe entstehen - und stürzt sie damit in tiefste Seelenpein.
Sophie reagiert schließlich verzweifelt, sucht Abenteuer mit
anderen Männern, nur um ihn eifersüchtig zu machen, seine Liebe zu erzwingen.
Erichs bisexuelle Orientierung wird an lediglich einer Stelle nur sehr vage
angedeutet. Eines Tages verschwindet sie überraschend ohne Abschied aus dem
Schloss. Ihre Spur verliert sich schnell, einiges deutet jedoch darauf hin, dass
sie sich den Bolschewiken angeschlossen hat. Nach einigen Monaten stehen beide
sich ganz unerwartet plötzlich gegenüber. Der Showdown, und hier speziell die
letzte Seite des Romans - ein wahrlich wirkungsstarker dramaturgischer Ablauf,
erhebt in seiner aufwühlenden Tragik die ganze, überaus fesselnde Geschichte in
die Problemsphären eines antiken Dramas, mehr will ich aber nicht verraten. Mich
hat diese letzte Szene jedenfalls, obwohl ich nicht gerade zart besaitet bin,
nicht nur zutiefst erschüttert, sie hat bei mir sogar körperliche Symptome
ausgelöst, ist mir auf den Magen geschlagen, so ungeheuerlich fand ich das
Geschehen. So was hat noch kein anderes Buch je geschafft.
«Das Geschehnis hat mich bewegt, und ich hoffe, dass es auch
den Leser bewegt», schreibt Yourcenar im Nachwort, eine in Romanen ja recht
selten anzutreffende Ergänzung des fiktionalen Textes, die sich hier als äußerst
wertvoll erweist. Denn eine derart berührende Geschichte wirkt nach, wirft
Fragen auf, und was könnte da hilfreicher sein als entsprechende Hinweise der
Verfasserin? Ihre Geschichte beruhe auf einer wahren Begebenheit, erfahren wir,
und auch ihre drei Hauptfiguren entsprächen im Wesentlichen der realen Vorlage.
Deren Psychogramme sind fein durchdacht und wirken stimmig, überhaupt beweisen
Handlung wie auch sprachliche Umsetzung der komplexen Geschichte große
literarische Könnerschaft, die das Lesen zum Hochgenuss werden lässt.
|