|
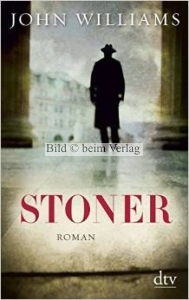 Kompliment an die Literatur Kompliment an die Literatur
Wiederentdeckungen gehören für mich zu den erfreulichsten
Ereignissen in der Welt der Literatur, weil sie, oft ja erst posthum, ein
Geständnis sind, dass einem vergessenen Autor mutmaßlich Unrecht widerfahren ist
von Seiten der Leserschaft. Der Roman «Stoner» von John Williams, bei seinem
Erscheinen 1965 wenig beachtet und erst mehr als vierzig Jahre später in den USA
neu publiziert, ist mal wieder ein Beispiel dafür. Erfolg ist launisch und
unberechenbar, der plötzlich ausbrechende Hype um dieses Buch hat die als «worst
case» angenommene Auflage von 4000 Exemplaren für den 2013 erstmals ins Deutsche übersetzten Roman auf weit über zweihunderttausend
hochschnellen lassen, wie man
einem Interview mit der Lektorin entnehmen konnte. Und «Stoner» ist plötzlich in
aller Munde, warum eigentlich?
Dieser Roman ist doch nur
die schlichte, keine Besonderheiten aufweisende Biografie eines Mannes, der als Bauernsohn
aus einfachsten Verhältnissen kommend an der Universität von Missouri Agrarwissenschaft
studieren soll. Er entdeckt seine Liebe zur Literatur, wechselt das Fach und
bleibt dann zeitlebens dort, wird Professor an der literaturwissenschaftlichen
Fakultät. Insoweit kann man auch von einem Campusroman
sprechen, der Unibetrieb nimmt jedenfalls einen breiten Raum ein in dieser
Lebensgeschichte eines eher linkischen, wenig zugänglichen Mannes. In 17
Kapiteln begleiten wir William Stoners mühsamen Weg zum angesehenen Hochschullehrer, der
oft allerlei
Anfeindungen und Querelen ausgesetzt ist, sich allzu häufig desinteressierten Studenten
gegenübersieht und seine wissenschaftlichen Ambitionen bald schon dem
kräftezehrenden Lehrbetrieb opfern muss, in dem er ebenfalls unauffällig bleibt,
jede Karrierechance für sich ausschlagend. Sein Privatleben ist ähnlich
unglamourös, er findet eine merkwürdig gehemmte Frau, heiratet sie und bekommt
eine Tochter, die er weitgehend alleine großziehen muss, weil die psychisch
labile Mutter sich wenig um sie kümmert, und auch seine Ehe scheitert kläglich,
wird zum Alptraum für ihn. Die Affäre mit einer jungen Doktorandin bringt ihm
nur ein kurzes Glück, auf Druck der Uni muss sie die Stadt bald Hals über Kopf
verlassen, der Kontakt zwischen ihnen bricht für immer ab. Als Stoners innig
geliebte Tochter schwanger wird und heiraten muss, verliert er in ihr seine
letzte familiäre Bindung; sie wird Kriegerwitwe, hat Alkoholprobleme, gibt das
Kind zu den Schwiegereltern. Und wir begleiten Stoner weiter bis zu seinem Krebstod, kurz
vor der anstehenden Emeritierung.
Ein solch konventioneller Plot kann, wie man sieht, kaum
ausschlaggebend sein für eine derart erfolgreiche Rezeption. Auch sprachlich
bietet dieser Roman nichts Besonderes, er ist stilistisch dem Sujet angepasst,
nüchtern erzählt, knapp und sparsam, leicht lesbar also. Mit einer
unterschwellig permanent spürbaren Spannung allerdings, die einen an den Text
fesselt, weil man stets einen
Umschwung erwartet, eine überraschende Wende. Die aber bleibt aus in der
einsträngig und strikt chronologisch erzählten Geschichte, - trotzdem ist man
fasziniert und darüber hinaus tief
betroffen von ihr.
Es wird nämlich nichts beschönigt in dieser Biografie eines stets
aufrichtigen, uneitlen, integeren Mannes, dessen unerschütterliche Leidenschaft
für die Literatur seinem äußerlich wenig erfreulichen Leben den Sinn gibt, allen
Fährnissen zum Trotz. Und genau darum beneiden wir ihn in unserem tiefsten
Inneren, begleiten ihn am Ende - buchstäblich bis zum letzten Atemzug - mit einer
ängstlichen Faszination, wie man sie ganz ähnlich auch beim «Jedermann» empfinden
mag. John Williams hat
wagemutig Grundfragen des Menschseins aufgegriffen in seinem Roman
und philosophisch Handfestes geliefert statt intellektuellem Geschwafel. Ihm ist
ein formidables Meisterwerk gelungen, in dem die Literatur die Hauptrolle spielt, Lebenssinn
verkörpernd. Kann man der Literatur denn überhaupt ein schöneres Kompliment machen?
|