|
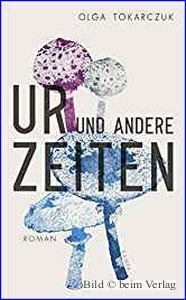 Zauber
als Narrativ Zauber
als Narrativ
Mit ihrem dritten, im Original 1996 erschienenen
Roman «Ur und andere Zeiten» hat die polnische Schriftstellerin Olga
Tokarczuk auch international den Durchbruch erreicht, er wurde in
mehrere Sprachen übersetzt. Die in ihrer Heimat aus
national-katholischen, xenophoben Kreisen heftig befehdete Autorin
wurde vor kurzem mit dem nachträglich für 2018
verliehenen Nobelpreis geehrt «für eine erzählerische
Vorstellungskraft, die mit enzyklopädischer Leidenschaft
Überschreitungen von Grenzen als Lebensform darstellt», wie die Jury
erklärte. Insoweit kann der Preis auch als demonstrative politische
Mahnung für ein weltoffenes, liberales Polen gedeutet werden. Als
studierte Psychologin ist die Autorin erklärtermaßen eine Anhängerin
von C. G. Jung, dessen Vorstellung von den «Archetypen» sie als
universell gültig begreift und in ihre Erzählungen einbezieht.
Dieses Bewusstsein für die Kontingenz von Identitäten ist prägend
auch für diesen Roman.
Das fiktive Städtchen Ur im östlichen Polen steht
unter dem Schutz der vier Erzengel. In einem breit angelegten Epos
wird über einen Zeitraum von etwa achtzig Jahren, vom Beginn des
Ersten Weltkriegs an bis in die Mitte der neunziger Jahre hinein,
vom Leben einiger archetypischer Bewohner erzählt. Deren
wechselvolles Schicksal in einer historisch derart ereignisreichen
Periode mit ihren politischen Umbrüchen und den zwei Weltkriegen
wird, vom Weltengetümmel auffallend abgehoben, ja geradezu entrückt,
aus einer zutiefst humanen Perspektive beschrieben. Das üppige
Figuren-Ensemble von durchweg urigen, exzentrischen Gestalten wird
erzählerisch, über Generationen hinweg, patchworkartig in hunderten
von kleinen Vignetten beschrieben. Momentaufnahmen quasi, deren
Überschriften regelmäßig mit «Die Zeit von …» beginnen. Ein
permanenter Hinweis also auf die Zeit als wissenschaftliches
Phänomen, auf das an einigen Stellen des Romans dann auch in
vertiefenden Reflexionen näher eingegangen wird.
«Ur ist ein Ort mitten im Weltall» lautet der
erste Satz. Er deutet damit schon gleich auf die Symbolhaftigkeit
dieser exemplarischen Erzählung hin, deren Thematik die ständige
Wiederkehr ist, in der Natur ebenso wie im menschlichen Leben mit
seinen Freuden und Leiden. Der rätselhafte Ort ist gleichzeitig auch
ein Bekenntnis zur Randständigkeit. Diesem Verwurzeltsein mit der
Heimat wird aber auch ein nicht nur geistiges Nomadentum
entgegengesetzt. Ein berührendes Beispiel dafür ist die grandiose
Schlussszene. Einer der Protagonisten, der Säufer Pawel, ist nach
einem entbehrungsreichen Leben allein zurückgeblieben, Gevatter Tod
hat in der Familie wie in der Nachbarschaft ganze Arbeit geleistet.
Nach zwei Jahrzehnten ohne jedweden Kontakt bekommt er nun
überraschend Besuch von seiner ins Ausland emigrierten Tochter. Sie
haben sich aber rein gar nichts mehr zu sagen und gehen wie zwei
Fremde verständnislos wieder auseinander. Zum Personal dieser
gelungenen Parabel vom Ewigmenschlichen gehören auch märchenhafte
Figuren wie der Böse Mann, der völlig der Kabbala verfallene
Freiherr, die im Wald lebende, ehemalige Dorfhure, der Wassermann
schließlich. Und natürlich Gott, der müde geworden ernsthaft
überlegt, ob er noch länger Gott bleiben will.
Als ein «metaphysisches Märchen» hat Olga
Tokarczuk ihr Buch von Geburt und Tod, Liebe und Hass, Glück und
Leid bezeichnet, ihr Glaube sei «der Blick auf die zerfließenden
Dinge», mit dem sie die Einheit von Ort und Zeit provokant negiert.
Der mit christlicher Symbolik üppig angereicherte Roman voller
Mythen und Wahngebilden ist trotz mancher Grausamkeiten in einer
Sprache voller Zauber und Poesie erzählt, in der selbst drastische
Begebenheiten im Krieg wie selbstverständlich eingebunden sind als
unabänderliche Begleiterscheinungen menschlicher Existenz. Diese
Reihung von Momentaufnahmen mit ihrem ständigen Wechsel zwischen
Realität und Mythos ist eine mitreißend erzählte Geschichte voller
Zauber, man kann sich ihr als Leser kaum entziehen.
|